Ahornstammkrebs (Eutypella parasitica)
Phytopathologe Dr. Thomas Cech vom Bundesforschungszentrum für Wald in Wien stellt uns in Steckbriefen wichtige Baumpilze vor, dieses Mal den Ahornstammkrebs. Aufgrund seiner Eigenschaft als Mikropilz ist er nicht im bald erscheinendem Buch „Baumpilze - 180 Arten schnell erkennen“ enthalten.
- Veröffentlicht am

Erkennbarkeit – Symptome und Fruchtkörper
Wenn am Stamm von Ahornbäumen bis zu 1 m lange, typischerweise einseitige Krebswucherungen auftreten, kann das die Folge einer Infektion durch den Stammkrebs Eutypella parasitica sein. Die Wucherungen entwickeln sich vorwiegend in unteren Stammpartien bis etwa 8 m Höhe. Frühe Infektionsstadien unterscheiden sich makroskopisch nicht signifikant von anderen rindenzerstörenden Mikropilzen.
Nach der Infektion, die über Wunden (Astabbruch etc.) erfolgt, bildet sich zunächst eine länglich-ovale Läsion, erkennbar als eingesunkene Fläche mit dunklerer Farbe als die umgebende lebende Rinde. Nach etwa fünf bis acht Jahren entwickeln sich in den Läsionen Fruchtkörper, die an der Rindenoberfläche als schwärzliche Punkte erscheinen und während der gesamten Vegetationsperiode Sporen produzieren. Aus den Läsionen entwickeln sich Baumkrebse, die schließlich in Längsrichtung aufreißen, so dass das Stammholz zutage tritt. An den Rändern der Baumkrebse kommt es zu massiven Überwallungen. In den abgestorbenen Rindenteilen, die bei Eutypella parasitica lange am Stamm haften bleiben, erscheint ein weißliches bis cremefarbenes Fächermyzel.
Die im Randbereich der Wucherung abgestorbene Rinde ist bei älteren Baumkrebsen oberflächlich schwärzlich, was auf die Mündungspapillen der tief in der Rinde eingebetteten geschlechtlichen Fruchtkörper zurückzuführen ist. Aus den Fruchtkörpern werden bei Temperaturen über 4 °C und Regen Sporen ausgestoßen. Letztere sind würstchenförmig, leicht gekrümmt und hellbraun.
Verwechslungsgefahr
Stammkrebse anderer pilzlicher Ursachen (z.B. Obstbaumkrebs Neonectria ditissima) oder große Stammverletzungen mit intensiver Wundkallusbildung können Eutypella-Krebsen ähneln, sind aber selten einseitig, nicht auf niedrige Stammregionen beschränkt und es fehlen die schwärzlich erscheinenden Flächen. Schwarz verfärbte Rinde kann beim Ahorn auch ein Symptom der Rußrindenkrankheit (Cryptostroma corticale) sein, doch sind bei dieser die schwarzen Flächen ausgedehnt breit streifenförmig und bestehen aus braunschwarzem Sporenstaub (Fingerprobe!). Häufig ist auch die Stegonsporium-Krankheit (Stegonsporium-Arten), deren Sporenmassen ebenfalls Teile von Ahornstämmen schwarz färben (nicht staubig). In beiden Fällen kommt es jedoch nie zur Krebsbildung und Ausbildung von Fächermyzel.
Schadwirkung im Baum
Eutypella parasitica verursacht außer den Wucherungen eine langsam fortschreitende Braunfäule. Bei Befall schwacher Stämme von etwa 10 bis 15 cm Durchmesser kann es nach einigen Jahren zum Abbrechen des Stamms kommen. Werden stärkere Stämme infiziert, entwickeln sich große Wucherungen, die meist erst nach vielen Jahren zum Stammbruch führen.
Herkunft und Verbreitung
Eutypella parasitica ist im nordöstlichen Nordamerika beheimatet und befällt dort verschiedene Ahornarten, am häufigsten Zuckerahorn (Acer saccharum) und Rot-Ahorn (A. rubrum). In Europa wurde die Art erstmals 2005 in Slowenien an Bergahorn (A. pseudoplatanus) und Feldahorn (A. campestre) nachgewiesen. Danach folgten Nachweise in Österreich (2006), Kroatien (2007), Deutschland (2013) und Tschechien (2017).
Mittlerweile ist der Eutypella-Stammkrebs weit verbreitet, vor allem in Slowenien, Tschechien und Deutschland (Großraum München). Die Art produziert auch bei niedrigen Temperaturen noch Sporen und kann daher auch in kühlen Klimaten überleben und sich verbreiten. Daher kommt es vor allem an kühlen Standorten mit anhaltender Luftfeuchtigkeit zu gehäuften Auftreten, wie z.B. in Fluss-begleitenden Ahornbeständen.
Vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Standortbedingungen)
Die Einschleppung von Eutypella parasitica in Europa erfolgte offensichtlich mit Pflanzenmaterial aus Nordamerika (Pflanzgut) und zwar, wie die Datierung alter Baumkrebse ergab, vermutlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts im urbanen Bereich. Ursache für den gegenwärtigen Anstieg der Zahl von Befallsherden dürfte die Zunahme des innereuropäischen Pflanzen- bzw. Holzhandels sein. Phytosanitäre Kontrollen und sofortige Entsorgung befallenen Pflanzgutes bereits während der Pflanzenproduktion kann die Ausbreitung verlangsamen.
Behandelnde Maßnahmen
Die Entwicklung von Eutypella-Stammkrebsen und auch die Ausbreitung erfolgt langsam - das erweitert den Zeitrahmen für erfolgreiche phytohygienische Maßnahmen zur Eindämmung zumindest im urbanen Raum. Die Chance, mittels regelmäßiger Überprüfung von Ahornbäumen infektiöse Stammkrebse zu entsorgen (Verbrennen) und damit den natürlichen Verbreitungsweg zu unterbinden, ist bei Eutypella parasitica grundsätzlich gegeben und sollte in den Aufgabenbereich von Baumtaxatoren Eingang finden.
Mehr dazu im Taschenatlas:

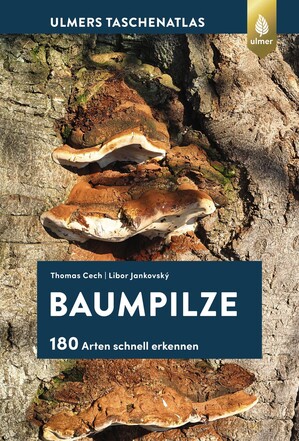




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.