Der Spindelige Rübling (Gymnopus fusipes)
Demnächst erscheint im Verlag Eugen Ulmer das Buch „Baumpilze - 180 Arten schnell erkennen“ von Dr. Thomas Cech und Prof. Dr. Libor Jankovský. Phytopathologe Dr. Thomas Cech vom Bundesforschungszentrum für Wald in Wien stellt uns daraus in Steckbriefen wichtige Baumpilze vor.
- Veröffentlicht am

Erkennbarkeit – Symptome und Fruchtkörper: Zurücksterben von einzelnen Ästen oder Kronenteilen von Eichen verbunden mit charakteristischen Fruchtkörpern an der Stammbasis sind ein Anzeichen für Wurzelfäule durch den Spindeligen Rübling (Gymnopus fusipes).
Die Fruchtkörper wachsen auf stammnahen abgestorbenen Wurzeln oder im Boden vergrabenem Holz in Stammnähe (oft scheinbar aus dem Boden). Sie sind pilzförmig (Hut und Stiel) und meist in Büscheln angeordnet. Der Hut ist braun bis fleischfarben und fleckig, kreisrund, lange glockenförmig, reif flacher, oft aber seitlich eingedrückt, oft buckelig im Zentrum und in leicht angetrocknetem Zustand rissig bzw. runzelig. Er misst 4 bis 8 cm im Durchmesser. Die Lamellen sind weit auseinander liegend, grau bis fleischfarben, fleckig, durch Anastomosen untereinander verbunden und ringförmig am Stiel angewachsen. Das Sporenpulver ist weiß.
Der Stiel ist oft abgeflacht, im zentralen Teil erweitert, voll bis hohl, mit gefurchter (gerillter) Oberfläche, fleischfarben bis dunkel rotbraun, bis 20 cm lang und bis 2 cm dick, an der Basis wurzelartig (spindelförmig) verlängert und zäh. Das Fruchtkörperfleisch ist weißlich bis blass bräunlich, knorpelig zäh, der Geruch ist leicht zimtartig, der Geschmack unbedeutend.
Verwechslungsgefahr: Die Fruchtkörper des Spindeligen Rüblings sind recht charakteristisch und können allenfalls mit einigen Rüblingen der Gattung Collybia verwechselt werden, deren Fruchtkörper aber andere morphologische Merkmale aufweisen und nicht mit Absterben von Eichen assoziiert sind. (Der wissenschaftliche Name des Spindeligen Rüblings war ehemals Collybia fusipes.)
Schadwirkung im Baum: Der Spindelige Rübling verursacht bei älteren Eichen eine langsam fortschreitende Kern- und Splintfäule (Weißfäule) der Wurzeln. In der Folge kommt es zu Kronensterben und aufgrund der Holzzersetzung in unteren Stammteilen einer erhöhten Bruch- und Wurfgefahr. Das Holz ist rötlichbraun verfärbt, in Starkwurzeln kann die Verfärbung fast orangerot sein: typischerweise bleibt die Verfärbung lange auf die untere Hälfte des Wurzelquerschnittes beschränkt.
Die Infektion erfolgt durch Sporen aus den Fruchtkörpern oder durch Myzelwachstum über Wurzelkontakte. Darüber hinaus kann der Spindelige Rübling auch als Saprophyt in abgestorbenem Holz überleben. Bei Stieleichen ist der Spindelige Rübling normalerweise nur schwach pathogen, die Wurzelfäule ist dort meist geringfügig und für den Baum nicht lebensbedrohend. Die Traubeneiche gilt als beinahe resistent. Im Gegensatz dazu ist die Roteiche (Quercus rubra) hochempfindlich, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Infektion und der Ausbreitung der Fäule maßgeblich von Klima sowie bestimmten Bodeneigenschaften gesteuert wird: Eine Kombination von Trockenstress, geringer Wasserspeicherkapazität und hohem Kalkgehalt in tieferen Bodenschichten fördert Infektionen durch den Spindeligen Rübling ganz erheblich.
Herkunft und Verbreitung: Gymnopus fusipes ist wahrscheinlich europäischen Ursprungs. Die Art ist in Europa weit verbreitet und wurde hier bereits im 18. Jahrhundert beschrieben. Schwerpunkte liegen in Südeuropa und Zentraleuropa, während sie in Nordeuropoa seltener ist. In Nordamerika ist der Spindelige Rübling ein in Roteichenbeständen gefürchteter Parasit.
Vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Standortbedingungen): Im Vordergrund vorbeugender Maßnahmen steht eine sorgfältige Auswahl geeigneter Standorte. Es ist sowohl darauf zu achten, dass der Boden kalkfrei ist und eine ausreichende Wasserspeicherkapazität aufweist. Weiters sind die Niederschlagssummen sowie Durchschnittstemperaturen sorgfältig zu überprüfen: So sollten die jährlichen Niederschlagsmengen nicht unter 600 mm liegen, in sommerwarmen Gebieten liegt dieser Schwellenwert noch höher.
Behandelnde Maßnahmen: Wie bei den meisten Wurzelfäuleerregern sind kurative Maßnahmen bei bereits weitgehend zerstörten Wurzelsystemen nicht mehr möglich. Hingegen ist bei Verdacht auf Wurzelschäden durch den Spindeligen Rübling eine Untersuchung der Baumstabilität unerlässlich, um Schäden durch umstürzende Bäume zu vermeiden.
Dr. Thomas Cech




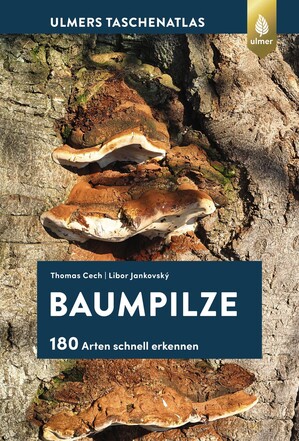

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.