
Forschungsprojekt „NachWinD“ gestartet
Im Juni startete das dreijährige Forschungsprojekt „Steigerung der Nachhaltigkeit und Präzision im Winterdienst durch Digitalisierung – NachWinD“. Ziel ist der Aufbau und die Evaluation eines nutzergerechten und lernenden IoT-Systems für die Winterdienstvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung. Dazu startet eine Umfrage – machen Sie mit!
von Dr.-Ing. Tobias Wilms erschienen am 19.08.2024Projektpartner sind das Fraunhofer-Institut mit Sitz in Lemgo, der INFA-ISFM e. V., ein An-Institut der FH Münster, und Okeanos Smart Data Solutions mit Sitz in Bochum. 2023 reichten sie den Projektantrag im Rahmen des Innovationswettbewerbs „GreenEconomy.IN.NRW“ ein. Nun wurden dafür EU-Mittel und NRW-Landesmittel bewilligt.

Bisher werden im Winterdienst überwiegend einzelne technische Systeme, oft auch losgelöst voneinander, eingesetzt. Das Expertenwissen liegt bei den langjährigen Mitarbeitenden. Im Projekt sollen technische und organisatorische Einzellösungen (zum Beispiel IoT, Sensorik, Softwarelösungen, Fahrzeugkomponenten, digital verfügbare Wetterdaten, Expertenwissen) zu einem abgestimmten Gesamtsystem Mensch-Prozess-Organisation-Technik zusammengeführt werden. (IoT – Internet of things – verbindet physische Objekte mit der virtuellen Welt. Geräte und Maschinen sind dabei miteinander und mit dem Internet vernetzt, Definition nach Telekom.)
Im Forschungsprojekt wird der zentralen Frage nachgegangen, wie die Einsatzhäufigkeit und der Streumittelverbrauch im Winterdienst aufgrund des gezielten Einsatzes des beschriebenen Gesamtsystems gesenkt werden können. Ziel ist es, die Umweltbelastung durch Emissionen und Salz zu senken und Kosten zu sparen.
Bessere Entscheidungsgrundlage für Einsatzleitungen
Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, dass verantwortliche Planende und Einsatzleitungen eine bessere Entscheidungsgrundlage erhalten, auf der sie Winterdienstbereitschaft anordnen und Einsätze ausrufen können. Tourenplanungen und die Streumittelausbringung könnten demnach zukünftig dynamisch an der Wetterlage ausgerichtet werden und sich auf die tatsächlich betroffenen Verkehrsbereiche beschränken. Dazu soll eine Vielzahl von Daten, zum Beispiel Wetter- und Klimadaten, Straßenbelagsinformationen und stadtspezifische Besonderheiten, in einer Datenbank zusammengeführt werden. Durch eine selbstlernende Softwarelösung sollen unter anderem KI-Modelle zukünftig individuelle Vorhersagen treffen und damit die Entscheidungen der Verantwortlichen absichern.
Umfrage unter Verantwortlichen startet
Um das Ergebnis des Projekts besser auf die Anforderungen der Einsatzleitungen im Winterdienst auszurichten, startet ab September 2024 eine breit angelegte Umfrage unter den Landkreisen, Städten und Gemeinden. Dabei sollen die Erfahrungen der Bau- und Betriebshöfe zur Einsatzplanung, -organisation und -durchführung abgefragt werden. Gleichzeitig werden die aktuellen technischen Möglichkeiten im Zusammenspiel zwischen Softwareanwendungen im Winterdienst, Wetterinformationen und Streutechnik am Markt erhoben und bewertet.
Nach dieser Grundlagenermittlung sollen verfügbare digitale Daten über verschiedene allgemeine und individuelle Parameter der Gebietskörperschaften zusammengeführt werden, welche die Einsatzhäufigkeit und die Streugutausbringung beeinflussen. Daraus abgeleitete, regionsspezifische Modelle zur Vorausberechnung anstehender Winterereignisse sollen im Anschluss für die Einsatzplanung und die Tourenführung verwendet werden. Pilotbereiche im Kreis Lippe und im Stadtgebiet von Paderborn dienen bereits im Winter 2025/2026 als Versuchsstrecken, um den Erfolg der Ergebnisse bewerten zu können. Im Projekt sind der Kreis Lippe – Eigenbetrieb Straßen, der ASP Paderborn und der Deutsche Wetterdienst als assoziierte Partner beteiligt.
Wenn Sie das Forschungsprojekt unterstützen möchten, können Sie bis zum 30. November 2024 unter diesem Link an der Umfrage teilnehmen.



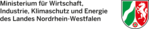









Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.