
Interview mit Dr. Philipp Unterweger
Kompetenzen aufbauen, berufliche Begeisterung und Wertschätzung wecken
Im Verlag Eugen Ulmer ist das Fachbuch „Multifunktionale und nachhaltige Grünflächen“ erschienen. Autor Dr. Philipp Unterweger, erfahrener Berater von Kommunen und Unternehmen, verrät, warum dieses Buch nötig war und wie man es in die Praxis umsetzen kann.
von Die Fragen stellte Claudia von Freyberg. erschienen am 02.10.2025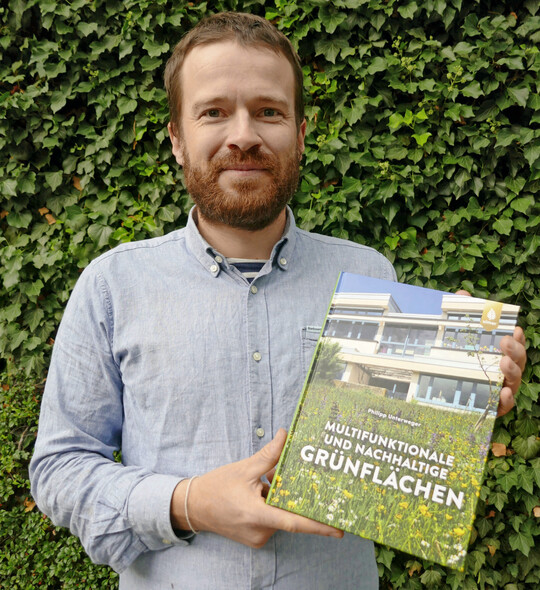
Dr. Philipp Unterweger hat in seinem Buch viele Experten aus der Praxis zu Wort kommen lassen. © privat
Wie schaffe ich es als Mitarbeiter in der Kommune, die Ämtergrenze zu überschreiten, ohne „übergriffig“ zu sein – wie könnte der erste Schritt aussehen? Vielleicht muss man sich in vielen Kommunen nochmals ganz klar über die Rolle des Nachhaltigkeitsbeauftragten werden. Die haben ja oft keine wirklich greifbare Funktion. Aber genau diese Menschen müssen die Moderatoren zwischen den Ämtern sein. Wenn diese Funktion nicht genutzt wird, dann sind diese Stellen falsch gewichtet. Das Buch heißt „Multifunktionale und nachhaltige Grünflächen“. Das Buch heißt ja nicht „Wie werde ich faul und lasse das Gras wachsen“. Grünflächen müssen vier Grundfunktionen erfüllen: Biodiversitätserhalt, Klimaschutz, Ernährung und gesellschaftliches Miteinander. Nachhaltig bedeutet: ökologisch, ökonomisch und sozial. Das sind vier Grundfunktionen, die jeweils drei Bedingungen erfüllen müssen. Das geht nicht nur in einem Amt. Das geht nur über die Ämtergrenzen hinweg mit den Gärtnerinnen und Gärtnern als Machern. Es geht ganz klar darum, dass wir den Beruf der Gärtnerinnen und Gärtnern wieder in den Fokus rücken. Das sind die Menschen, die aktiv handeln können. Sie entscheiden über Wohlergehen, Schatten, Schmetterlinge und frische Luft – sowohl auf dem Sportplatz als auch im Park, im Straßenbegleitgrün und auch im privaten Umfeld. Gärtner sind die Macher einer enkeltauglichen Stadt - wir müssen sie stolz machen und ermächtigen, dass sie Stadtlandschaften schaffen, die uns glücklich machen. Wenn ich Dienstleister für eine Kommune bin und sehe, dass bestimmte beauftragte Maßnahmen unsinnig sind (wie Keulenschnitt bei Gehölzen), andere wiederum nötig wären, aber nicht beauftragt sind: Wie kann ich die Tür für ein Umdenken aufstoßen? Die, die beauftragt sind, sind entweder die Günstigsten, oder es gibt ein langjähriges Vertrauensverhältnis. In letzterem Fall ist Qualitätsmanagement sicherlich leichter. „Hauptsache Abrechnen“ ist vielerorts das Motto. Grundsätzlich glaube ich, dass wir weg von der Vergabe müssen. Wir brauchen kommunale Kompetenzzentren, die wieder stolz auf ihre Arbeit sind. In jedem Park ein Gärtnerhäuschen mit gelebter Verantwortung.
Wir müssen den Beruf der Gärtnerinnen und Gärtner wieder in den Fokus rücken. Das sind die Menschen, die aktiv handeln können. Dr. Philipp Unterweger
„Wir brauchen kommunale Kompetenzzentren, die wieder stolz auf ihre Arbeit sind.“ Dr. Philipp Unterweger
Mehr zum Thema:
0 Kommentare



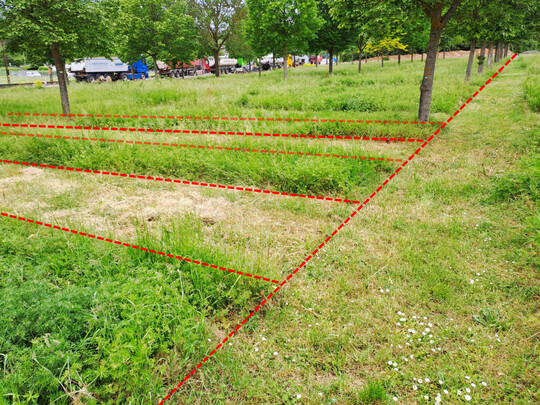





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.