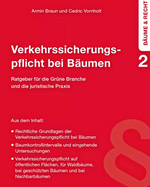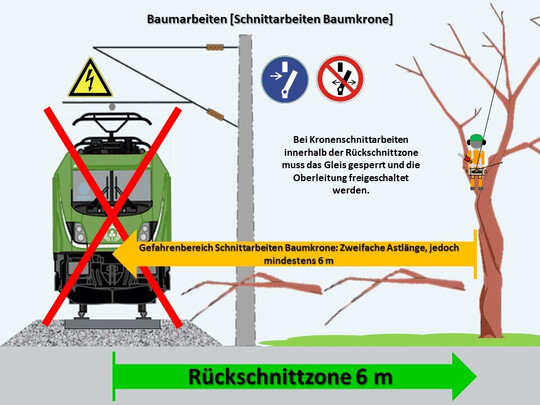Was unterscheidet Baumkontrolleure von Baumsachverständigen?
Die Anforderungsprofile für die Baumkontrolle und die Sachverständigentätigkeit weichen erheblich voneinander ab. Selbst ein langjährig erfahrener Baumkontrolleur darf sich somit nicht Baumsachverständiger nennen, wenn er nicht die Voraussetzungen für die Sachverständigentätigkeit erfüllt.
von Prof. Dr. Dirk Dujesiefken erschienen am 05.11.2025Der Grund für eine Baumkontrolle ist meist die Verkehrssicherheit, das heißt eine Kontrolle hinsichtlich der Stand- und Bruchsicherheit sowie an Straßen zusätzlich hinsichtlich des Lichtraumprofils. Die Kontrolle erfolgt vom Boden aus. Die FLL-Baumkontrollrichtlinien führen zu der fachlichen Eignung aus, dass die Regelkontrollen von Personen durchzuführen sind, die über ausreichende Fachkenntnisse verfügen. Sie müssen
- Schäden und Schadsymptome nach Abschnitt 5.2.2.2 der Richtlinie erkennen können
- diese nach Art und Umfang sowie Gefährdungspotenzial einschätzen können
- das weitere Vorgehen gemäß Abschnitt 5.2.4 der Richtlinie festlegen können
- in der Lage sein, den Bedarf notwendiger Baumpflegemaßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege zu benennen und ihre Dringlichkeit festzulegen.
Die Ergebnisse einer Baumkontrolle werden üblicherweise in ein Baumkataster eingetragen.
Diese Fachkenntnisse werden im Rahmen der Prüfung zum FLL-zertifizierten Baumkontrolleur überprüft. Die Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung sind in der Prüfungsordnung der FLL festgelegt. Danach ist zur Prüfung zugelassen, wer volljährig ist und mindestens ein Jahr in der Baumpflege/Baumkontrolle mit Weiterbildung gearbeitet hat. Abweichend hiervon kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.
Kann durch die Baumkontrolle die Verkehrssicherheit des Baumes nicht abschließend geklärt werden, muss nachfolgend eine Eingehende Baumuntersuchung gemäß FLL-Baumuntersuchungsrichtlinien (2013) erfolgen. Die FLL-Baumkontrollrichtlinien führen dazu aus: „Zur Durchführung von Eingehenden Untersuchungen sind dafür speziell weiter- und fortgebildete sowie erfahrene Personen erforderlich, die über entsprechende Fertigkeiten und Fachkenntnisse verfügen, um die Verkehrssicherheit eines Baumes abschließend beurteilen zu können.“ Häufig handelt es sich dabei um eine andere Person, häufig Vorgesetzte oder externe, zum Beispiel Sachverständige.
Die erforderlichen Arbeiten einer Baumuntersuchung sind somit nicht Teil der Baumkontrolle, nicht Inhalt der FLL-Baumkontrollrichtlinien und deshalb auch nicht Teil der Zertifizierung der FLL, die auf eben diesen Richtlinien basiert. Eine hierdurch nachgewiesene Sachkunde zur Überprüfung der Verkehrssicherheit qualifiziert damit nicht zur Durchführung und Auswertung eingehender Untersuchungen – was letztendlich auch haftungsrechtlich von Relevanz ist.
Das fachliche Vorgehen bei der Baumkontrolle ist in den Richtlinien für Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit beschrieben. Sie wurde bei der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) erarbeitet und ist das erste Mal 2004 herausgegeben worden. Außergewöhnlich schnell fand dieses Regelwerk Eingang in die Praxis. Zugleich wurde damit auch das Anforderungsprofil an die Person, die eine Baumkontrolle durchführt, dargestellt. So war es auch erstmals möglich, Schulungen und vor allem auch Zertifizierungen speziell für diese Tätigkeiten zu etablieren.
Die Zertifizierung der FLL ist inzwischen eine anerkannte Qualifikation für die Baumkontrolle. In knapp 20 Jahren wurden allein in Deutschland über 8.000 Personen auf dieser Basis von der FLL zertifiziert. Vor 16 Jahren wurde auch eine FLL-Zertifizierung für Österreich eingeführt und hat sich dort ebenfalls etabliert. Es gibt weitere Zertifizierungen von anderen Institutionen wie die Landwirtschaftskammer NRW, die Akademie für Landschaftsbau Weihenstephan sowie die DEULA, die ebenfalls entsprechende Abschlüsse anbieten.
Anforderungen an Sachverständige
Aufgrund neuer wissenschaftlicher und technischer Entwicklungen sowie der wachsenden Zahl an Rechtsvorschriften, Normen und Regelwerken sind viele Institutionen sowie Privatpersonen immer häufiger auf die Hilfe unparteiischer Sachverständiger angewiesen. Sie geben durch die sachkundigen Feststellungen von Tatsachen, die fachliche Beurteilung von Sachverhalten sowie den Erklärungen von Geschehensabläufen Entscheidungshilfen für fachliche Laien. Dies können beispielsweise Behörden, Versicherungen oder Gerichte sowie natürliche Personen sein. Gutachten sollen fehlendes Fachwissen vermitteln.
Die Gründe, warum Sachverständige beauftragt werden, sind vielfältig. Im Baumpflegebereich geht es häufig um die Vorhersehbarkeit von Schäden, Baumkrankheiten und Sanierungsmöglichkeiten, Fragen der Verkehrssicherheit, den möglichst langen Erhalt von Bäumen, um den Baumschutz auf Baustellen oder die Ermittlung des Wertes von Gehölzen im Zuge von Schadensregulierungen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Sachverständiger eine Person, die von einer bestimmten Sache mehr versteht als andere Personen. Die Begriffe „Gutachterin/Gutachter“ sind lediglich ein Synonym für die selbe Tätigkeit. „Sachverständiger“ ist der offizielle Begriff. Er wird in Gesetzestexten vor Gericht sowie auch von den Bestellungskörperschaften so benannt (zum Beispiel öffentlich bestellte und vereidigte (ö.b.v.) Sachverständige).
Außer der öffentlichen Bestellung und Vereidigung gibt es weitere Möglichkeiten für eine Sachverständigentätigkeit. Beispielsweise ist der „amtlich anerkannte Sachverständige“ speziell für die technische Überwachung geschaffen worden, der der staatlichen Aufsicht untersteht. Auch gibt es verbandsgeprüfte Gutachter sowie zertifizierte Sachverständige nach DIN EN ISO 17024. Im Baumbereich üblich sind jedoch der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige (ö.b.v. Sachverständige) sowie der freie Sachverständige (Weihs 2019, Bayerlein et al. 2021).
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
Die Bedeutung der öffentlichen Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen besteht darin, Gerichten, Staatsanwaltschaften, Behörden und allgemein der Öffentlichkeit Sachverständige anzubieten, deren besondere Sachkunde oder erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse und persönliche Zuverlässigkeit von einer Bestellungsbehörde überprüft und öffentlich anerkannt worden ist. Für ö.b.v. Sachverständige ergibt sich daraus die Pflicht, den vom jeweiligen Auftraggeber vorgegebenen Sachverhalt unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch fachlich zu beurteilen oder zu bewerten. Dies gilt für Gerichts- und Privataufträgen in gleicher Weise. Gutachten müssen dabei nicht nur im Ergebnis richtig sein, sie müssen zugleich auch ausreichend begründet und verständlich sein.
Vorausgesetzt wird meist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer einschlägigen Fachrichtung für das beantragte Sachgebiet mit mindestens sechs theoretischen Studiensemestern an einer Hochschule nach Hochschulrahmengesetz oder besonders qualifizierte Antragsteller mit abgeschlossener Berufsausbildung (in der Regel Meister oder gleichwertiger Abschluss). Neben einer fachspezifischen Ausbildung ist ständige Weiterbildung auf dem Tätigkeitsgebiet zum Nachweis der besonderen Sachkunde beziehungsweise der erheblich über dem Durchschnitt liegenden Fachkenntnisse erforderlich. Die Teilnahme an geeigneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in den letzten Jahren vor der erstmaligen Antragstellung oder Wiederbestellung muss nachgewiesen werden.
Die Bestellung setzt außerdem eine einschlägige Berufserfahrung voraus. Die Berufstätigkeit, die im Zeitpunkt der Antragstellung andauert, soll mindestens fünf Jahre betragen und in verantwortlicher Stellung ausgeübt werden. Sie muss geeignet sein, die erforderlichen praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bestellungssachgebiet zu vermitteln.
Bei dem Bestellungsgebiet oder Tätigkeitsfeld handelt es sich meist um ein Teilgebiet (Spezialgebiet) eines Berufes. Deshalb sind beispielsweise Handwerksmeister, Ingenieure oder Forstwirte nicht automatisch Sachverständige, obwohl jeder dieser Berufe Spezialwissen voraussetzt. Sachverständige sind demgegenüber erheblich stärker spezialisiert. Angehörige eines Berufsstandes werden erst dann Sachverständige, wenn diese sich auf einem abgrenzbaren Gebiet eines Berufes besondere Detailkenntnisse verschafft haben.
Sachverständige müssen zudem verstehen, wie das geforderte Gutachten in die rechtliche Situation einzuordnen ist und worauf es beispielsweise bei einem Beweisbeschluss bei Gericht ankommt. Von Sachverständigen wird daher verlangt, dass sie Grundkenntnisse des für ihr Bestellungsgebiet betreffenden einschlägigen EU-, Bundes- und Landesrechts sowie Kenntnisse des auf die Sachverständigentätigkeit bezogenen Verfahrensrechts nachweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundkenntnisse des Entschädigungs-, Schadensersatz-, Haftungs- und Versicherungsrechts sowie der einschlägigen Rechtsprechung, soweit diese das Bestellungsgebiet betreffen. Ergänzend werden Detailkenntnisse gefordert, insbesondere über die Rechte und Pflichten von Sachverständigen. Hierzu gehören die Abwicklung von Gerichtsaufträgen, die Durchführung eines Ortstermins, Grundlagen des Beweisrechts, das selbständige Beweisverfahren, Verhalten bei Besorgnis der Befangenheit und der Einsatz von Hilfskräften.
Diese Kenntnisse sind ebenfalls im außergerichtlichen Verfahren von Bedeutung. Die private Sachverständigentätigkeit kann erhebliche Bedeutung haben, und zwar nicht nur bei der außergerichtlichen Klärung von Rechtsansprüchen, sondern auch bei der Auskunfts-, Beratungs-, Prüf- und Überwachungstätigkeit gegenüber jedermann. Sachverständige müssen daher über fundierte Kenntnisse hinsichtlich ihrer Tätigkeit in außergerichtlichen Verfahren verfügen. Hierzu gehören vor allem Kenntnisse über Rechte und Pflichten von Sachverständigen sowie über Verträge und AGB-Vorschriften. Weitere Aspekte sind Fragen der Haftung und der Haftungsbeschränkung sowie des Einsatzes von Hilfskräften.
Die Anforderungen an die Personen, die sachverständig tätig sind, werden in der Rechtsprechung und in den Sachverständigenordnungen der Bestellungskörperschaften in Deutschland sehr hoch angesetzt, da deren Tätigkeiten in der Regel großen Einfluss auf fremde Entscheidungen haben und in der Folge zudem weitreichende Folgen für die Betroffenen haben können. Hierbei wird nicht zwischen gerichtlichen und nichtgerichtlichen (privaten) Gutachten unterschieden.
Eine Sachverständige oder ein Sachverständiger ist somit eine natürliche Person mit einer besonderen Sachkunde und einem überdurchschnittlichen fachlichen Expertenwissen auf einem Fachgebiet. Diese besondere Sach- und Fachkunde ist jedoch nicht die einzige Voraussetzung für die Sachverständigentätigkeit. ö.b.v. Sachverständige müssen zusätzlich auch über die erforderliche persönliche Eignung verfügen. An ihrer persönlichen Zuverlässigkeit und Integrität dürfen keine Zweifel bestehen. Dies setzt voraus, dass Sie sich bisher rechtskonform verhalten haben und in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben.
Die Bestellung von Sachverständigen ist in Deutschland Ländersache und erfolgt durch die Bestellungskörperschaften. Für Baumsachverständige zuständig können die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer, Architekten- oder Ingenieurkammer oder das Regierungspräsidium sein.
Freie Sachverständige
Der Begriff des „freien“ Sachverständigen wurde von den Sachverständigenverbänden geprägt. In der Literatur werden die Bezeichnungen „privater“ sowie „selbst ernannter“ Sachverständiger vorgeschlagen. Hierunter gehören alle Sachverständigen, die ohne jegliche Kontrolle am Markt als Gutachter tätig sind sowie auch die Personen, die lediglich privatrechtlich organisierten Berufsverbänden angehören.
Zuweilen wird behauptet, dass sich jeder als freier Sachverständiger bezeichnen darf, der sich für sachverständig hält. Auch wenn es für die Sachverständigentätigkeit keine behördliche Zulassung gibt, kann die Bezeichnung „Sachverständige“ oder „Sachverständiger“ aber auch als Täuschung gewertet werden, wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Ausführliche Informationen hierzu finden sich in dem Buch „Sachverständigenrecht“.
Folgerungen
Die Ausführungen machen deutlich, dass die Anforderungsprofile für die Baumkontrolle und die Sachverständigentätigkeit erheblich voneinander abweichen. Selbst ein langjährig erfahrener Baumkontrolleur darf sich somit nicht (freier) Baumsachverständiger bezeichnen und auch nicht als solche auftreten, wenn nicht die Voraussetzungen für die Sachverständigentätigkeit erfüllt sind.
Um dennoch auf besondere Kenntnisse in einem Spezialgebiet hinzuweisen (zum Beispiel im Briefkopf und auf der Homepage), kann auf andere Begriffe ausgewichen werden. Bezeichnungen wie Experte, Sachkundiger oder Fachfrau bieten keine Verwechslungsmöglichkeiten mit einer Sachverständigentätigkeit und können somit auch nicht als Täuschung ausgelegt werden. Wer einer Sachverständigentätigkeit nachgehen möchte, sollte prüfen, ob eine öffentliche Bestellung ein gangbarer Weg wäre.
Baumkontrolleure können auch Baumsachverständige werden
Im Laufe eines Berufslebens kommt bei vielen die Idee auf, später auch eine Sachverständigentätigkeit anzubieten. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einige möchten die körperlich eher schwere Tätigkeit am Baum reduzieren und andere möchten sich weiterentwickeln und sich neuen Aufgaben zuwenden. Manche lockt auch der Titel „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ und sie erhoffen sich eine Erweiterung ihres Geschäftsfeldes und lukrative Aufträge.
Die Bestellung von Sachverständigen ist in Deutschland Ländersache und hat viele Besonderheiten. Eine Bestellung kann nur in dem Bundesland beantragt werden, wo sich der Hauptwohnsitz des Antragsstellers befindet (Stichwort: Residenzpflicht). Für viele Sachgebiete sind die Industrie- und Handelskammern (IHK) und/oder die Architektenkammern zuständig. Für die „grünen“ Berufe sind es häufig die Landwirtschaftskammern. Der Verband der Landwirtschaftskammern veröffentlicht im Internet die Aufstellung der Bestellungsbehörden in Deutschland nach Bundesländern gegliedert. Wie der genaue Weg zum Baumsachverständigen führt, ist Thema eines zweiten Teils dieses Artikels, den wir beim nächsten Mal veröffentlichen.
Dieser Beitrag ist in Gänze zum ersten Mal im Jahrbuch der Baumpflege 2024 erschienen und wurde von Prof. Dr. Dirk Dujesiefken auf den Deutschen Baumpflegetagen 2024 in Augsburg vorgetragen (inklusive der nach wissenschaftlicher Norm geforderten Quellen). Das Literaturverzeichnis finden Sie im Anschluss.
- Bayerlein, W.; Bleutge, K.; Roeßner, W., 2021: Praxishandbuch Sachverständigenrecht. 6. überarbeitete und erweiterte Auflage, C.H. Beck Verlag, München, 1103 S.
- Bleutge, P., 2003: Sachverständige – Inhalt und Pflichten ihrer öffentlichen Bestellung. DIHK, Berlin, 6. Aufl., 160 S.
- Dujesiefken, D, 2007: Die FLL-Baumkontrollrichtlinie. Zur Umsetzung sowie zur Zertifizierung von Baumkontrolleuren. Baumzeitung, Braunschweig, 41 (2), 18-19.
- Dujesiefken, D., 2009: Verkehrssicherheit und Baumkontrolle – Erfahrungen mit der FLL-Baumkontrollrichtlinie und Hinweise für die Praxis. Forstwiss. Beiträge Tharandt, Beiheft 8, 108-114.
- Dujesiefken, D., 2023: Nachvollziehbar und nachprüfbar: Die Anforderungen an ein schriftliches Gehölzgutachten. In: Dujesiefken, D.; Amtage, T.; Streckenbach, M. (Hrsg.), 2023: Jahrbuch der Baumpflege 2023. Haymarket Media, Braunschweig, 194-201.
- FLL-Baumkontrollrichtlinien, 2020: Richtlinien für Baumkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), Bonn, 52 S.
- Henkel, R.; Rust, S.; Dujesiefken, D., 2007: Erste Erfahrungen mit der FLL-Baumkontrollrichtlinie – Ergebnisse einer Umfrage zur Akzeptanz und Umsetzung bei den Kommunen in Deutschland. Stadt und Grün, Hannover, Berlin, 56 (2), 57-59.
- Institut für Baumpflege (Hrsg.), 2022: Verkehrssicherheit und Baumkontrolle. Der Praxisleitfaden zu den FLL-Baumkontrollrichtlinien. Haymarket Media, Braunschweig, 200 S.
- Neimke, L.; Sachmerda, A., 2012: Der Sachverständige und seine Auftraggeber. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 216 S.
- Rickert, A., 2011: Sachverständige – Rechte und Pflichten. DIHK-Verlag, Meckenheim, 7. Aufl., 184 S.
- Ulrich, J., 2019: Der gerichtliche Sachverständige. Ein Handbuch für die Praxis. 13. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln, 652 S.
- Weihs, U., 2019: Was unterscheidet den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (ö.b.u.v. SV) von anderen Sachverständigen? In: Dujesiefken, D. (Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2019. Haymarket Media Braunschweig, 214-221.
- ZPO: Zivilprozessordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005 (BGBl. I S. 3202, ber. 2006 I S. 431, 2007 S. 1781) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.11.2022 (BGBl. I S. 1982) m.W.v. 12.11.2022
- AGS - Arbeitsgemeinschaft Sachverständige Gartenbau | Landschaftsbau | Sportplatzbau
- BDSF - Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter
- BVS - Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger
- DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag
- FLL – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau
- HLBS - Hauptverband der Landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen
- IfS - Institut für Sachverständigenwesen
- SAG – Sachständigen-Arbeitsgemeinschaft Baumstatik
- SVK - Sachverständigen Kuratorium.
- Olaf Pressel 07.11.2025 08:51Ich wollte Herrn Dujesiefken bitten, noch ein paar Worte zur Einordnung der baumschutzfachlichen Baubegleitung zu verlieren. Es entstehen immer mehr Parallelstrukturen in den beruflichen Bezeichnungen, die eher zu Verwirrung als zur Verbesserung der Lage beitragen. Einige Jahre bevor der Begriff baumschutzfachliche Baubegleitung (von der FLL?) ins Leben gerufen wurde gab es bereits den Begriff Umweltbaubegleitung, welche zu einem erheblichen Anteil diejenigen Bereiche enthält, welche sich eben später als baumschutzfachliche Baubegeleitung etablierte. Welche fachlichen Voraussetzungen diejenigen Personen nun im Kontext der Ausführungen zum Baumkontrolleur und dem öbuv-Sv besitzen sollten ist mir nicht ganz klar geworden. Ich denke, dass da eine genaue Abgrenzung genauso gefordert ist und klargestellt werden sollte was die einzelnen Begriffe/BerufeBezeichnungen beinhalten und wie sie sich unterscheiden. Eine Verwirrung wie damals als die FLL den zertifizierten Baumkontrolleur auf den Markt warf sollte sich nicht widerholen. Damals wurden ETW, ETT und Fachagrarwirte von Ausschreibungen der öffentl. Hand ausgeschlossen weil sie angeblich den FFL-zertifitzierten Baumkontrolleur nicht nachweisen konnten. Ich bitte daher um eine Einordnung ALLER Begriffe.Antworten